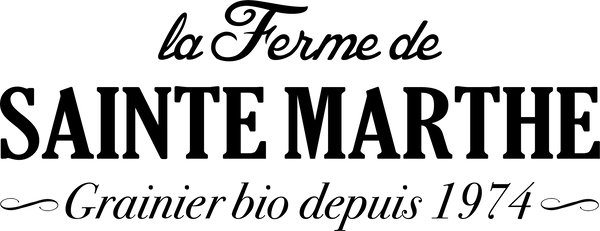Verstehen Sie Ihren Boden mit Bioindikatorpflanzen
Diagnose Ihres BodensDie Bestandsaufnahme Es gibt einige Fallstricke, die Sie vermeiden sollten: - Seien Sie bei der Wahl des Standorts für die Bestandsaufnahme vorsichtig. Überprüfen Sie durch allgemeine Beobachtung sorgfältig die Homogenität des Grundstücks und unterteilen Sie es in Zonen, wenn es heterogen erscheint. - Einige verstreute Pflanzen sind nicht von Bedeutung, ebenso wie Pflanzen nur aufgrund der wenigen Quadratdezimeter, die sie bedecken, aussagekräftig sind. Zumal wir Gärtner, die sich leicht über die zwei oder drei nicht ausreißbaren Ampfer oder die wenigen von Winden befallenen Stellen ärgern, dazu neigen, sie zu überschätzen. - Vermeiden Sie diese Analyse im Winter, wenn viele Poaceae und einjährige Pflanzen verschwunden sind oder wenn das relative Fehlen oberirdischer Teile die Identifizierung erschwert. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt auch für gemähte oder geschnittene Flächen. Die Identifizierung wilder Pflanzen ist nicht einfach. Während sich der Laie in den Artenbeschreibungen zurechtfindet, ist die Unterscheidung der Varietäten deutlich komplexer. Dennoch ist dieser Aspekt sehr wichtig. Die drei häufigsten Kochbananenarten beispielsweise spiegeln jeweils eine völlig andere Umgebung wider. Eine falsche Identifizierung führt zu Fehlern. Nehmen Sie sich daher Zeit, beobachten Sie ausführlich und nutzen Sie vor allem die Fauna- bzw. Beschreibungsblätter als Hilfe. Wiederherstellungsrate: Sobald die Bestandsaufnahme abgeschlossen ist, ermitteln Sie die Wiederherstellungsrate für jede Art. Weisen Sie dann jedem einen Koeffizienten dieser Rate zu: 100 %: Koeffizient 5; 75 %: Koeffizient 4; 50 %: Koeffizient 3; 25 %: Koeffizient 2; – 25 %, jedoch mit signifikanter Präsenz: Koeffizient 1; Ein paar verstreute Füße: das + Zeichen. Nachdem jeder Art eine Nummer zugewiesen wurde, kann die Analyse beginnen. Gegenüber jedem dieser Merkmale notieren wir die Merkmale des jeweiligen Unkrauts und die Addition dieser Indizes kann uns dann dabei helfen, eine präzise Diagnose zu stellen. Was lehren uns diese Pflanzen? Die folgenden Beschreibungen wurden ausgewählt, weil sie in unseren Gemüsegärten recht häufig vorkommen. Sie stammen aus den von Gérard Ducerf erstellten Dateien. Diese wenigen Beispiele reichen zwar nicht aus, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, ermöglichen Ihnen jedoch bereits eine Vorstellung von einem Boden und wecken möglicherweise den Wunsch, die Analyse weiter zu vertiefen. Quecke (Elytrigia repens)Jeder Gärtner hatte mindestens einmal in seinem Leben die Gelegenheit, mit dieser mehrjährigen Süßgräserart mit ihren langen, kriechenden Rhizomen und ihrer außergewöhnlichen Vermehrungsfähigkeit in Kontakt zu kommen. Während sein primärer Lebensraum der Schwemmsand der Flüsse und Bäche war, wurden seine sekundären Lebensraumtypen die intensiv bewirtschafteten Felder, Weinberge, Obstgärten und seit langem gepflegten Gärten, Hecken und Straßendämme sowie die Uferböschungen von Kanälen, Flüssen und Bächen. Was lehrt uns die Quecke? Bodenermüdung oder -degeneration aufgrund von aufeinanderfolgendem Pflügen, überschüssigem Nitrat und Kali, Verdichtung von Schluffböden mit hohem pH-Wert und hohem Wasserkontrast. Acker-Winde (Convolvulus arvensis) Hand hoch, wer sie nicht in seinem Gemüsegarten hat! Es ist schwierig, dieser lästigen invasiven Pflanze aus dem Weg zu gehen, und der Einsatz rotierender Werkzeuge macht es noch schwieriger. Dieses Windengewächs mit hübschen weißen oder rosa Blüten hat als primären Lebensraum nährstoffreiche Auentäler. Kulturland und Gärten, Straßenränder und gestörte Brachen bilden seinen sekundären Biotop. Was lehrt uns die Winde? Winde weist auf eine Sättigung des Ton-Humus-Komplexes mit Stickstoff hin. Außerdem kommt es zu einem Überschuss an Ammoniumnitrat oder organischen Stoffen und zur Bodenverdichtung. Löwenzahn (Teraxacum officinale) Was kann uns diese mehrjährige Korbblütlerin mit ihren hübschen, leuchtend gelben Blüten und im Wind fliegenden Samen lehren? Es entstand aus natürlichen Wiesen in den Ebenen und Bergen sowie aus Kalkstein- und Basaltplateaus und verfügt über ein ziemlich ausgedehntes sekundäres Biotop: landwirtschaftliche Wiesen, Weinberge, Obstgärten, Straßenränder usw. Was sagt uns der Löwenzahn? Löwenzahn weist auf Bodenverstopfung mit organischer Substanz, Verstopfung durch Kälte und Verdichtung hin. Solange es nicht dominant ist, ist es ein guter Indikator für üppige Wiesen. Portulak (Portulaca oleracea) Diese hübsche, fast vollständig auf dem Boden liegende und einer Sukkulente ähnelnde einjährige Pflanze stammt aus Indien. Der primäre Lebensraum dieser Portulacea sind die Sande und Schluffe von Schwemmlandtälern. Als wärmeliebende Pflanze kommt sie im Allgemeinen im Süden Frankreichs vor, aber auch weiter nördlich in warmen Mikroklimata. Sein sekundäres Biotop ist recht ausgedehnt: Ackerflächen, Weinberge, Obstgärten, Gemüsegärten, Familiengärten, Brachland, Straßenränder und Wege. Was lehrt uns Portulak? Aus dem Vorkommen von Portulak in unseren Gärten können wir viel lernen: Böden mit geringer Rückhaltekapazität, Erosion und Auswaschung nackter Erde, Setzung und Verdichtung des Bodens. Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius) Jeder Gärtner, der versucht hat, diesen Ampfer auszureißen, wird sich sicherlich an dieses Erlebnis erinnern! Wie kann man eine solche Wurzel ausreißen? Der extrem lange und kräftige Drehpunkt macht die Bedienung nahezu unmöglich. Interessant ist, dass dieser Ampfer zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch sehr selten war und heute ein weit verbreitetes Unkraut ist. Ursprünglich handelte es sich um eine Pflanze aus feuchtem Schlamm und Schlick, Sümpfen und Torfmooren. Heute findet man ihn häufig auf Wiesen