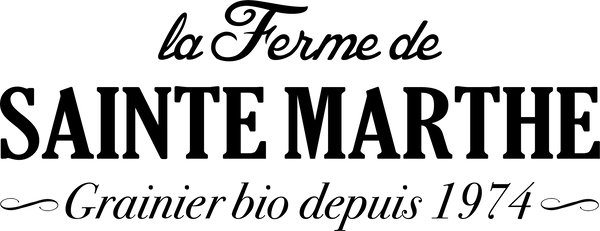Was sind Bioindikatorpflanzen?
Das Prinzip besteht nicht darin, mit dem Bestimmungsblatt in der Hand durch den Garten zu gehen, um vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern ein allgemeines Phänomen besser zu verstehen. Ein wenig Geschichte ist zunächst immer aufschlussreich. Wer sich leidenschaftlich für dieses Thema interessiert, kann sich auf die hervorragende Arbeit von Gérard Ducerf beziehen.
Ein bisschen Geschichte
Aerobes Leben ...
Das aerobe Leben entstand vor 400 Millionen Jahren und veränderte unseren Planeten, als moosartige Pflanzen die Meeresküsten besiedelten. Vereinfacht ausgedrückt bilden diese Moose eine einfache Humusschicht, auf der sich ein- und zweijährige krautige Pflanzen ansiedeln können. Diese bilden bei ihrer Zersetzung außerdem Humus, wodurch sich Stauden entwickeln können. Diese Humusschicht verdichtet sich weiter und nun sind die baumartigen Stauden an der Reihe, Wurzeln zu schlagen. Dieses Phänomen der Besiedlung der terrestrischen Umwelt durch die Pflanzenwelt entspricht dem, was die Natur wiederholt, wenn der Boden freigelegt wurde:
1. Auftreten von Einjährigen, die ohne Syntaxon leben und erhebliche Wurzelexsudate produzieren;
2. Die Ansammlung von Exsudaten hemmt die Keimung der einjährigen Pflanzen und es entwickeln sich die krautigen zweijährigen Pflanzen (Pflanzen, die ihren Zyklus in 2 Jahren abschließen).
3. Es erscheinen krautige Stauden (Lebensdauer von 3 bis 100 Jahren);
4. Schließlich kommen die strauchartigen Stauden (verholzter Stamm und oberirdische Knospen, mit einer Lebensdauer von 50 bis 150 Jahren) vor den baumartigen Stauden (Pflanzen mit Stamm, Ästen, die oberirdische Knospen tragen und 50 bis 150 Jahre alt werden können).
...auch im Gemüsegarten
Dieser Zyklus ermöglicht dem Gärtner ein besseres Verständnis dafür, warum beim Roden eines neuen Grundstücks ständig neues Unkraut keimt. Tatsächlich unterbrechen viele Faktoren die Keimruhe von Hunderttausenden von Samen, die im Boden vorhanden sind und die nur dann zu wachsen beginnen, wenn günstige Bedingungen gegeben sind – zur großen Überraschung des „Landroders“.
Biotope
Acht primäre Umgebungen
Manche Pflanzen können in Symbiose leben: Was für die eine schädlich ist, kann für die andere von Nutzen sein. Zusätzlich zu diesen Assoziationen gibt es Tiere, die wiederum von den zwischen Pflanzen aufgebauten Beziehungen leben. Diese Tiere nehmen nicht nur Nutzen aus der Umwelt, sondern tragen auch zu ihrem Leben bei: Sie transportieren Samen und Pollen, produzieren Abfall usw. Diese sogenannte „symbiotische“ Umgebung, in der jeder vom anderen abhängig ist, ist das „Biotop“. Diese natürlichen Umgebungen wurden aufgelistet und in acht primäre Umgebungen eingeteilt.
Die Kenntnis des primären Lebensraums eines Unkrauts ist eine wertvolle Lernquelle. Das offensichtlichste Beispiel ist das berühmte Ambrosia, das für seine allergenen Eigenschaften bekannt ist. Diese einjährige Pflanze, die natürlicherweise in Wüstengebieten wächst, entwickelt sich zu einer gewaltigen invasiven Pflanze. Seine Botschaft an den Gärtner, der davon heimgesucht wird, ist daher klar: Sie schaffen eine künstliche Wüste!
Sekundärbiotope
Der Mensch greift in die Natur ein und schafft künstliche Lebensräume oder sekundäre Biotope: Ebenen, Bergwiesen, großflächige Ackerflächen, Gemüseanbau usw.
Der Gemüsegarten und damit auch der Gemüsegarten
Die Verdichtung der Erde
Der Begriff „Gemüseanbau“ leitet sich vom englischen Wort „Sumpf“ ab und bezeichnet hydromorphe Räume (die Wasser speichern) voller organischer Stoffe. Obwohl diese Bodenarten für Gemüse geeignet sind, handelt es sich um ein fragiles Gleichgewicht. Der Gärtner, der regelmäßig große Mengen Kompost und Dünger hinzufügt und das ganze Jahr über und insbesondere im Sommer, einer Zeit, in der der Boden traditionell keine Wasser aufnehmen kann, gießt, schafft diese Art von Umgebung. Es besteht daher ein hohes Risiko einer Anaerobiose (Vermehrung von Bakterien, die ohne Sauerstoff leben) aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Kohlenstoff und Stickstoff einerseits und der starken Verdichtung des Bodens andererseits, die mit den zahlreichen Arbeiten verbunden ist, die der Gärtner durchführen muss: Gießen, Unkraut jäten, Ernten usw. So viele Möglichkeiten, selbst für die Respektvollsten, herumzutrampeln und den Boden noch mehr zu ersticken. Es ist auch schwierig, den Boden in unseren Gemüsegärten in gutem Zustand zu halten: Er wird ständig bearbeitet und im Winter oft brach liegen gelassen. Mechanische und klimatische Erosion richten erheblichen Schaden an.
Unkraut
Begleitet werden diese Erkrankungen von symptomatischen Unkräutern wie der Kriechenden Quecke (Elytrigia repens), dem Ampfer (Rumex crispus und Rumex obtusifolius), der Ackerwinde (Calystegia sepium und Convolvulus arvensis) und insbesondere dem Kriechenden Hahnenfuß (Renonculus repens). Diese Pflanzen sind typisch für Böden, die mit Wasser und organischen Stoffen gesättigt sind. Acker-Wolfsmilch (Spergula arvensis), Waldsauerklee (Oxalis corniculata, Oxalis fontana) und Portulak (Portulaca oleracea) keimen, wenn die Erosion der im Winter kahlen Böden stark zu werden beginnt.
Es gibt jedoch Lösungen: Das Vorhandensein dieser Unkräuter in Gärten sollte als Warnung und nicht als endgültiger und unheilbarer Zustand betrachtet werden.
Ausgleich der Beiträge
Es liegt in der Verantwortung des Gärtners, seine Beiträge möglichst zwischen pflanzlichem Kompost und tierischem Kompost auszugleichen, soweit möglich zu versuchen, Grasflächen mit sehr langen Parzellenwechseln zu belassen (5 Jahre sind schwierig, aber ideal) und vor allem die Verdichtung zu begrenzen und genau auf die verwendeten Geräte zu achten. Rotierende Werkzeuge (Bodenfräse, Fräse etc.) glätten die Bodensohle und machen sie luft- und wasserundurchlässig. Bevorzugen Sie gezahnte Werkzeuge, die eine deutlich geringere Schlagkraft haben: Kanadier, Tiefenlockerer oder einfach eine Grabegabel und einen Haken für Handwerkzeuge. Achten Sie außerdem darauf, den Boden nur zu bearbeiten, wenn er völlig trocken ist, weiterhin vernünftig zu gießen und alles zu tun, um die Bewässerung einzuschränken: Mulchen, Hacken usw. Alle Tipps zur Vermeidung einer großen Wasseraufnahme sind willkommen.